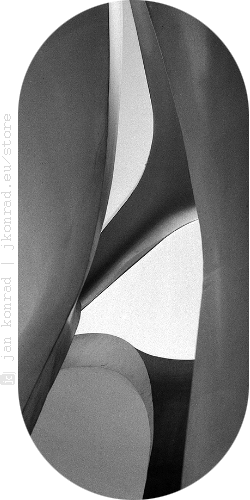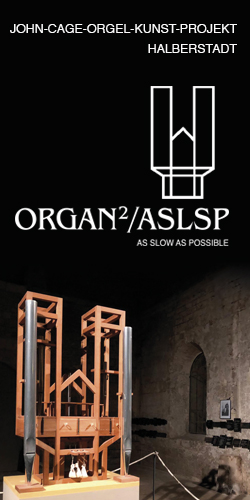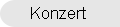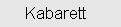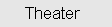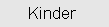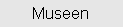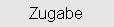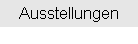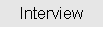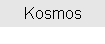Dieser Rafail Belokrinitskij trägt deutliche Züge des Autors, dessen Schicksal für Hunderttausende Bewohner der damaligen Sowjetunion typisch war. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde er vom Berüchtigten NKWD (Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten) verhaftet, wegen scheinbarer konterrevolutionärer Propaganda angeklagt und zu etlichen Jahren Lagerhaft in einem Gulag (ein Netz von Straf- und Arbeitslagern in den sibirischen Weiten der Sowjetunion) verurteilt. Vierzehn Jahre verbrachte Demidow im Lager Kolyma, wo er auch den Autor Warlam Schalamow kennenlernte.
Wie durch ein Wunder überlebte Demidow die Zeit der brutalsten Repressalien und begann, nachdem sein Traum als Physiker zu arbeiten geplatzt war, anschließend schriftstellerisch tätig zu werden. Er schrieb ausschließlich auf der Schreibmaschine, da ihm im Gulag etliche Finger erfroren waren. 1980 wurden sämtliche Manuskripte Demidows und die in seinem Besitz befindlichen Schreibmaschinen beschlagnahmt. Demidow starb als ein gebrochener Mensch.
Durch die Reformen der aufziehenden Perestroika und dem Engagement seiner Tochter Walentina Demidowa tauchten seine Manuskripte wieder auf und „Fone Kwas oder Der Idiot“ ist nunmehr der erste Roman aus dem Nachlass Demidows, der in deutsche Sprache übersetzt wurde.
Man darf davon ausgehen, dass vieles von dem, was Damidow seinen Helden widerfahren lässt, autobiographische Züge aufweist. Die Hauptfigur Rafail Belokrinitskij aus „Fone Kwas oder Der Idiot“ durchlebt die körperliche und seelische Hölle – um letztendlich unschuldig und zu Jahren der Zwangsarbeit verurteilt zu werden. Anfangs glaubt er noch, dass seine Festnahme ein Versehen sei und sich dieser Irrtum schnell auflösen würde. Doch die drastischen Geschehnisse in Zelle 22, in der sich ausschließlich Opfer Stalins willkürlicher Verhaftungswellen befinden, lehrt ihn mit der Zeit: Der NKWD irrt sich nie und das Schicksal seiner Gefangenen und Gefolterten ist ihm gleichgültig.
Belokrinitskijs wird gezwungen, seine Anklageschrift selbst zu verfassen. Aus Angst vor weiterer Folter entwirft er ein völlig unlogisches, widersinniges Konstrukt, in der stillen Hoffnung, seine Peiniger würden diesen Irrsinn erkennen, darauf eingehen und seine Unschuld bemerken. Doch Belokrinitskijs fällt, wie Thomas Martin in seinem Nachwort so treffend schreibt, wie einst sein Autor, „in das Räderwerk von Stalins Terror, Zacken eines Zahnrads aus dem Surrealen Getriebe der Macht.“ Rafail Belokrinitskijs steht wie alle anderen Insassen des Gefängnisses unter Generalverdacht und wird gnadenlos abgeurteilt.
Georgi Demidow entwirft diesen Text in einer eher nüchternen Sprache, ohne starke emotional wirkende Anteilnahme, was dieser Geschichte erst recht diesen grausamen Unterton gibt. Er erzählt die Geschehnisse mit der Präzision und Schärfe eines beobachtenden Wissenschaftlers und beschreibt eine surreale Welt in der Realität. Ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit!
Jörg Konrad
Georgi Demidow
„Fone Kwas oder Der Idiot“
Galiani
„Fone Kwas oder Der Idiot“
Galiani